Das Content Management System (Schul-CMS) auf WordPress-Basis steht allen staatlichen Hamburger Schulen kostenlos zur Verfügung. Die zentrale Administration und den Support übernimmt die BSB. Die Schulen pflegen ihre Webauftritte, ohne sich um technische Details kümmern zu müssen. Jede interessierte staatliche Hamburger Schule kann sich für die Nutzung » online anmelden.
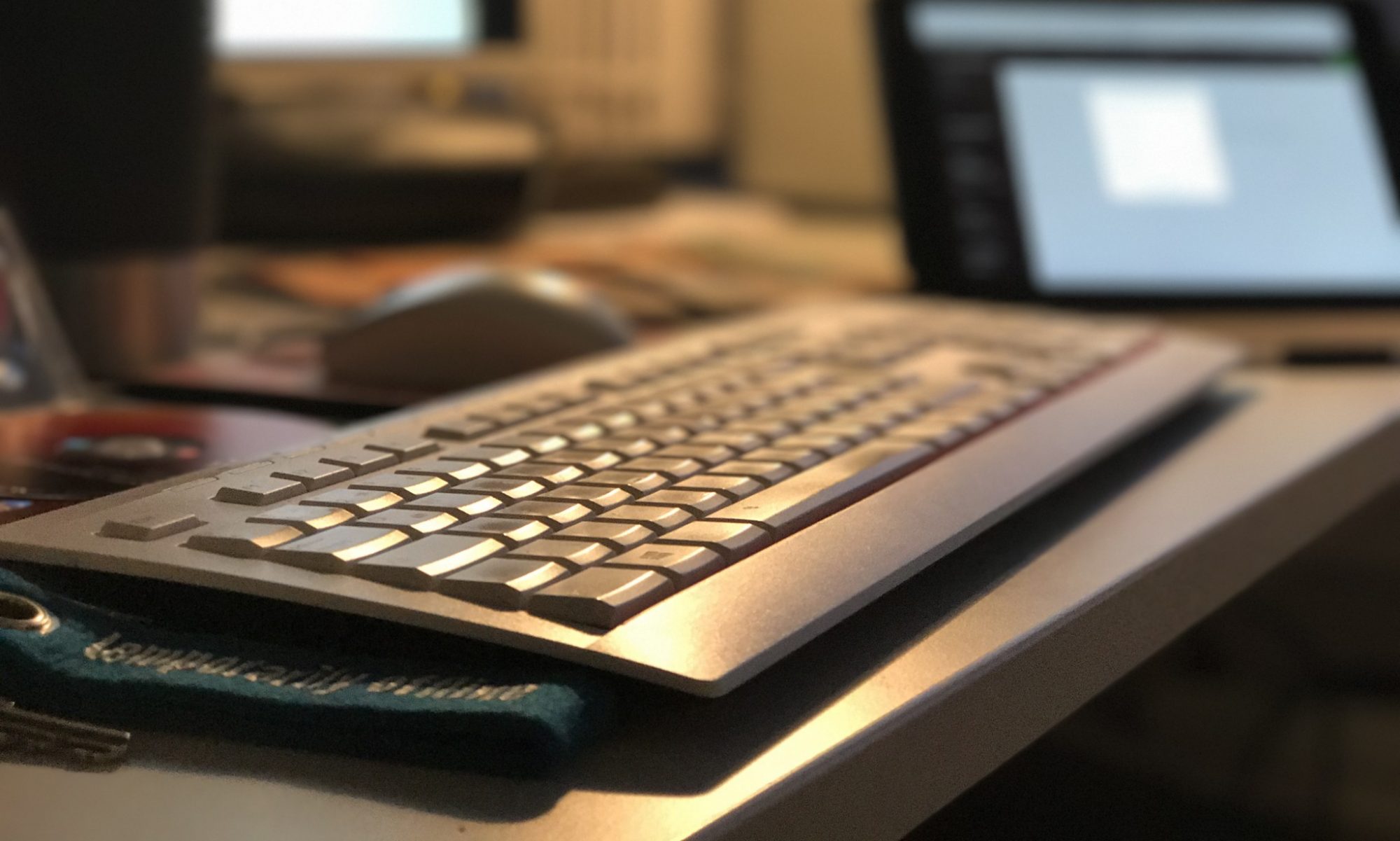
Schulhomepages
Das Hamburger Schul-CMS